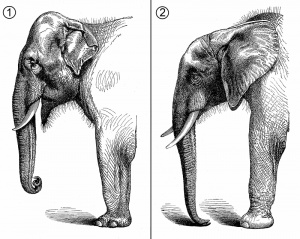Warum immer mehr Elsässer zum Essen ins Badische kommen
 Langsam zieht der Storch seine Bahn. Ein letzter Schlag seiner mächtigen Schwingen, dann hat er den Rhein überquert und ist – das Elsass hinter sich lassend – im Badischen gelandet. Er liebt ihn, den kleinen Grenzverkehr. Und er ist nicht allein. Storch und Elsässer – beide treibt die Suche nach Nahrung nach Baden. Beide sind auf der Suche nach Essbarem, wobei der Elsässer dem Froschschenkel ausdrücklich adieu gesagt hat. Es scheint, als hätte er seit längerem die Badische Küche für sich entdeckt.
Langsam zieht der Storch seine Bahn. Ein letzter Schlag seiner mächtigen Schwingen, dann hat er den Rhein überquert und ist – das Elsass hinter sich lassend – im Badischen gelandet. Er liebt ihn, den kleinen Grenzverkehr. Und er ist nicht allein. Storch und Elsässer – beide treibt die Suche nach Nahrung nach Baden. Beide sind auf der Suche nach Essbarem, wobei der Elsässer dem Froschschenkel ausdrücklich adieu gesagt hat. Es scheint, als hätte er seit längerem die Badische Küche für sich entdeckt.
Hinter sich gelassen hat er die Verführungen der heimischen Küche, z.B. das übliche Hors d‘ Oevre‚ was in der Regel die ‚Assiettes de crudites´ beinhaltet und bei dem sich ein paar farbstoffanimierte Wursträdchen an drei müde Salatblättchen schmiegen. Vielleicht gibt’s vorher aber auch eine Scheibe Pâté, deren Einkaufspreis (‚Prix choc’) man aus der Wursttheke des ‚Hypermarche’ kennt. Viele haben vielleicht auch genug vom ‚Choucroute garni’, bei dem die schiere Masse des Gebotenen verdeckt, dass die Würste und der ganze liebe Rest zu lange im Siedewasser gelegen waren und nach rein garnichts mehr schmecken. Das Wasser hätte man besser verwendet, um die Kartoffeln nach guter alter VaterMütter Sitte zu kochen. Gibt’s aber nicht. Die ‚Krumbeere’ sind meist in Heißluft gegart, was ihnen die fahle Farbe eingetrieben und den Geschmack ausgetrieben hat.
Der eine oder andere hatte vielleicht auch genug vom ‚Wädele’, das es sich, mit eigenem Fett reichlich gepolstert, auf dem Teller mit ‚Hansi’ – Dekor gemütlich gemacht hat.
Genug hat man vielleicht auch von den elsässischen Bieren, die – ursprünglich der Stolz französischer Braukunst – ‚Fischer’ oder ‚Kronenbourg’ heißen und die für den hiesigen Durst nicht übermäßig geeignet sind. Ob darüberhinaus ein französischer Hahn danach kräht – auch daran mag man zunehmend zweifeln.
Wer allerdings kein Bier mag, dem steht es frei, einen Wein zu bestellen. Im Glas findet er dann oft genug – wo nicht gar den Edelzwicker – einen Allerweltsriesling, der geschmacklich flach daherkommt und so schmeckt, wie viele elsässische Rieslinge halt seit Jahrzehnten so schmecken. „Das sind populistisch süße Weine“, so ein kaiserstühler Spitzenwinzer.
Selbst wenn ‚unser’ Elsässer jetzt noch loyal am Mythos des gesegneten Landstrichs festhält und all dies hat geduldig über sich ergehen hat lassen, spätestens, wenn es ans Bezahlen geht wird der Preis für das Gebotene den Ureinwohner endgültig aus dem Stuhl in der rot-weiß dekorierten Bauernstube heben. Machen wir’s kurz: Essen und Trinken ist im Elsass zu teuer geworden. Zudem hat es sich in den letzten Jahren nicht nennenswert weiterentwickelt.
sich ergehen hat lassen, spätestens, wenn es ans Bezahlen geht wird der Preis für das Gebotene den Ureinwohner endgültig aus dem Stuhl in der rot-weiß dekorierten Bauernstube heben. Machen wir’s kurz: Essen und Trinken ist im Elsass zu teuer geworden. Zudem hat es sich in den letzten Jahren nicht nennenswert weiterentwickelt.
Natürlich gibt’s im Elsass eine Spitzengastronomie, wie etwa die ‚Auberge de l’Ill in Illhaeusern’, und auch auf dem breiten Land finden sich Restaurants, auf die der oben beschriebene Zustand nicht zutrifft. Die Sterne strahlen natürlich auch jenseits des Rheins. Aber in der Breite gesehen scheint es, dass die hiesigen Gastronomen seit Jahren einen verstärkten Zustrom an Gästen aus dem Nachbarland verzeichnen.
Das war früher anders. Da zogen Heerscharen badischer Gäste jedes Wochenende mit Kind und Kegel (der Verfasser weiß, wovon er spricht) ins Elsass, um gut Essen zu gehen. Der kleine gastronomische Grenzverkehr war zum Synonym der Lebensart geworden. Kaum dass der Opel Kadett von der Fähre rollte, ließ man sich vom dort Aufgetischten gern belehren, was auf einem Teller kulinarisch so alles möglich ist.
Hinter uns gelassen hatten wir damals Zigeuner-, Jäger- und sonstige Varianten des Schweineschnitzels mit den dazugehörigen fetten Soßen, Bergen von Spätzle und andere Sättigungsbeilagen wie giftgrüne Erbsen oder die zu kleinen Kugeln geformte Gelberüben. Nach dem Kurs in Sachen Lebensart ging’s dann wieder zurück ins Badische (meist über weitere Strecken, da die Fähre ihren Betrieb mittlerweile eingestellt hatte), und es blieb das Gefühl, einen erfüllten Tag erlebt zu haben. Der Ausflug hatte sich gelohnt. Man war satt und vor allem gut satt geworden!
Aber ach. Lang, lang ist’s her. Ein Hin und Her gibt’s freilich immer noch, nur eben in die andere Richtung. Und so freuen sich Gastronomen wie Edmund (‚Eddi’) Baier im ‚Bauhöfer’s Bräustüb’l’ seit einigen Jahren über die zunehmende Gästezahl aus dem Elsass.
Nach den Gründen gefragt bringt er es erst einmal mal auf den Punkt: „Unser Angebot stimmt einfach“. Und ergänzt selbstbewußt: „Wir sind einfach besser“. Das liege zunächst einmal am Preis/Leistungsverhältnis; man bekommt hier Gutes zum besseres Preis. Hier bewege man sich einfach mehr. Über alles gesehen experimentiert man drüben einfach zu wenig; man ist eingefahren. Als Beispiel nennt er – durchaus nicht uneigennützig- das naheliegende Thema Bier. Die Brauerei in Ulm bringt immer mal wieder neue Biersorten auf den Markt. ‚Doppelbock’, ‚Maibock’, ‚Mondscheinbier’, ‚Kellerbier’. Andere Brauereien im Badischen machten das ähnlich.
Dann geht er weiter ins Detail. Die 35 Stunden Woche macht die Gastronomie drüben weniger rentabel. Die Lokale öffnen teilweise Punkt 12 Uhr und keine Minuten früher (er bringt Beispiele). 14 Uhr wird pünktlich geschlossen. Um 19 Uhr wiederholt sich das Ganze und dann könne es sein, dass der Gast um 21.30 Uhr schon wieder auf der Straße sitzt. Zwei Tage in der Woche hat man geschlossen.
Das System sei zu unbeweglich, daran lasse man aber nicht rütteln. So kommen die Elsässer zu uns, kaufen sie darüber hinaus noch ein. Viele Selbstvermarkter, beispielsweise rund um Oberkirch, leben gut vom Obst-, oder Schnapsverkauf an die Gäste. Zudem wird vieles an Obst oder Gemüse (besonders Spargel) wird im Elsass kaum mehr angebaut. Die Elsässischen Wirte kaufen den Spargel längst im Badischen. Schuld sei – wie man das beim Maisanbau beobachten kann – der Hang zu Monokultur.
 Zurück zu strukturellen Problemen. So sieht auch der Zweisterne Gastronom Meinrad Schmiederer an erster Stelle das Preis-Leistungs-Verhältnis, das für die hiesigen Betriebe spreche. Auch er merkt an, dass man mit einer starren 35 – Stunden Regelung kaum hinkäme. Hier sind es 42 Stunden plus möglicher Überstunden: „Das macht uns flexibel“.
Zurück zu strukturellen Problemen. So sieht auch der Zweisterne Gastronom Meinrad Schmiederer an erster Stelle das Preis-Leistungs-Verhältnis, das für die hiesigen Betriebe spreche. Auch er merkt an, dass man mit einer starren 35 – Stunden Regelung kaum hinkäme. Hier sind es 42 Stunden plus möglicher Überstunden: „Das macht uns flexibel“.
Anzumerken ist zudem noch, dass verglichen mit dem französischen Steuersatz die hiesigen Wirte im Nachteil sind. Während in Frankreich auf gastronomische Leistungen ein Steuersatz von 7 Prozent erhoben wird, fällt in die hiesigen Betrieb ein Satz von 19 Prozent an. Ein klarer Nachteil, der die dortige Gastronomie eigentlich bevorzugen sollte. Wenn – wie immer mal wieder gemunkelt wird – der Steuersatz demnächst weiter angehoben werden soll, dann, so scheint es, geht garnichts mehr.
Doch die Gastronomie kämpft auch noch mit anderen Problemen. Fritz Keller vom ‚Schwarzen Adler’ in Oberbergen konstatiert ein zunehmendes Restaurantsterben auf Grund der französischen Steuerpolitik. Zu vererbende Familienbetriebe sind auf Grund der steuerlichen Belastung kaum mehr zu vererben. Söhne oder Töchter sehen keine Möglichkeit, einigermaßen kostenneutral den Betrieb zu übernehmen. „Die ist das Ergebnis einer zentralistischen Neidpolitik“. So werde zu Lebzeiten der Eltern nichts mehr investiert. Wozu auch? Auch dies spielt der hiesigen Gastronomie in die Hände.
Dass von nichts nichts kommt, ist eine Binsenweisheit. So recht verständlich wird die erst, wenn man sich vor Augen hält, dass der Französische Nationalfeiertag – das Hochamt französischen Nationalgefühls – seit 20 Jahren mit großem Tamtam ausgerechnet auf der gegenüberliegenden Rheinseite, auf dem Dollenberg, gefeiert wird. Die zentralistisch denkenden Franzosen haben den Elsässern mit ihrer Grenzlage nie so ganz getraut. Aber wie hätte Paris erst geschaut, hätte es gesehen, dass die von Meinrad Schmiederer zur Willkommesparade am 14. Juli verpflichteten Bad Peterstaler Schulkinder sogar mit französischen Fähnchen winkten, was den Gästen aus dem Elsass die eine oder andere Träne ins Auge trieb -allein das hätte Paris zu denken geben müssen.
 Es ist wahr – man soll um Geschriebenes nicht zu viel Gedöns machen. Was geschrieben ist, ist vorbei. Neues kommt, Altes geht. Und schon gar nicht sollte man darauf hoffen, dass sich durch unser Geschriebenes irgendetwas ändert oder die Welt gar eine Bessere wird. Wer so etwas denkt, sollte zu einer Tageszeitung gehen.
Es ist wahr – man soll um Geschriebenes nicht zu viel Gedöns machen. Was geschrieben ist, ist vorbei. Neues kommt, Altes geht. Und schon gar nicht sollte man darauf hoffen, dass sich durch unser Geschriebenes irgendetwas ändert oder die Welt gar eine Bessere wird. Wer so etwas denkt, sollte zu einer Tageszeitung gehen.