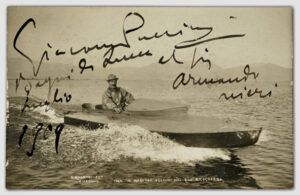Es war im Juni diesen Jahres, als ich mich zusammen mit meiner Begleiterin auf der Suche nach Wärme ins südfranzösische Arles begab. Was uns dort aber erwartete, war eine schier unerträgliche Hitze. Zudem war mir, als verspürte ich coronabedingt ein leichtes Kratzen im Hals. In meinem Entschluss, Arles zu verlassen, sah ich mich weiter aber auch dadurch bestärkt, dass ich in Arles an den Straßenrändern mehrere verendete Tauben sah. So wie sie da lagen, hatte man es offensichtlich nicht für notwendig befunden, die toten Tiere zu entfernen. Man hatte sie dort einfach liegen gelassen, und es sah aus, als wäre die städtische Müllabfuhr schon längere Zeit um sie herum weite Umwege gefahren. Angesichts dieses Elends beschlossen wir, uns zunächst einmal ins nicht allzu weit entfernte Aiges Mortes abzusetzen, wo wir hofften, in Gesellschaft einer gesunden Schar fröhlich vor sich hin gurrender Tauben, das Leben auch weiterhin genießen zu können.
Aiges Mortes ist, tief in der Provence gelegen, bei all seiner mittelalterlich gemütlichen Anmutung, bei all den heimeligen Gässchen, Cafes und Türmchen letztlich doch eine Festungsstadt geblieben. Die Stadt sollte der erste Zugang Frankreichs zum offenen Meer werden. Gegründet wurde sie von Ludwig IX., auch „der Heilige“ genannt, womit seine Zeitgenossen sich auf seine ‚Milte’, seine Frömmigkeit und Barmherzigkeit bezogen. Er war von seinen Zeitgenossen und der Nachwelt gleichermaßen hoch geschätzt.
Damals glücklich von einer Malariaerkrankung genesen, beschloss er aus Dankbarkeit seinem Schöpfer gegenüber ein Gelübde abzulegen. So begab er sich auf den ersten von zwei Kreuzzügen ins Hl. Land. Rückblickend waren beide wenig erfolgreich. Doch hatte das Kreuz, das er nahm, ihm offensichtlich den Blick aufs kriegsführerisch Notwendige verstellt.
Nachdem er kurz vor seiner Abreise für seine Kinder noch beschauliche Traktate verfasst hatte, landete er zunächst in Nordafrika. Das war im Juli 1248 und zudem noch in der schlimmsten Mittagshitze. Das Unternehmen stand denn auch nicht unter einem glücklichen Stern. Sein Scheitern war absehbar. Glaubt man seinem getreuen, ihn begleitenden Chronisten Jean de Joinville, durfte man von anfänglich etwa ca 15 000 Streiter ausgehen. Die aber wurden alsbald von Seuchen dezimiert, von Gegnern hingeschlachtet oder gerieten in Gefangenschaft. Das erging dem König und seinem Kompagnon nicht viel anders. Doch wurde der König gegen ein enormes Lösegeld freigelassen, und auch sein Chronist kam, nach vorübergehender Sklaverei, frei und erreichte endlich Frankreich. Das sollte ihm eine Lehre sein.
Denn kaum zurück, plante Ludwig der Heilige schon wieder den nächsten Kreuzzug. Auch dieser sollte im neuerbauten Aiges Mortes seinen Anfang nehmen. Und wieder erging eine freundliche Einladung an seinen Seneschal Jean de Joinville, der aber diesmal freundlich abwinkte. Er hatte – wie man so sagt – den Braten gerochen und sich unter fadenscheinigsten Vorwänden (Heirat und absehbare Familiengründung) abgeseilt, worauf er später als kluger Mann starb. Wie klug er war, mag man daraus ersehen, dass Jean de Joinville im nahezu biblischen Alter von 90 Jahren das Zeitliche segnete. Nicht ganz so gut erging es seinem König, der nicht lange nach seiner Abreise zu seinem 2. Kreuzzug von Aiges Mortes aus in Nordafrika landete und dort, kurz nach der Einnahme von Karthago, krankheitsbedingt verschied.
War die Macht des französischen Königs zu diesem Zeitpunkt auch noch ungeteilt, der König selbst war es nicht.
Nach gut mittelalterlicher Herrscher-Sitte wurde nach dem Tod sein Fleisch in einer Wein-Essig Lösung von den Knochen gelöst. Die Gebeine wurden zunächst in der Abtei Saint-Denise in Paris bestattet. Doch wanderte später eine Rippe in die Kathedrale von Notre Dame, mehrere Finger bekam König Haakon V. von Norwegen. Andere Knöchelchen des Königs finden wir damals in der Kirche von Vadstena in Schweden usw. usf.
Zeit also, des französischen Königs zu denken.
Aus diesem Grund stand ich nun auf der Burgmauer von Aiges Mortes und ahnte, von den Zinnen weit in die Ferne blickend, das Meer und das baldiges Scheitern des Unternehmens. Anders als in Arles bestrahlte mich hier auf der Mauer eine nicht ganz so sengende Sonne. Ihre Hitze wurde von einer moderat milden Sorte des Mistral gemindert. Nach der Flucht vor ca fünf toten Tauben schien mir das Leben hier deutlich angenehmer als im heißen Arles, das ja, wie man weiß, auch schon van Gogh nicht gut bekommen war. Und doch sollte das Leben hier, auch in vermeintlich kommoder Umgebung, für mich noch eine Überraschung bereithalten.
Denn, auf der Mauer stehend, frischte plötzlich der Wind wieder auf. Eine wilde Böe umtoste mein Haupt und blies mir den Hut vom Kopf. Er flog in weitem  Bogen tief unter mir in den Burggraben. Dieser Burggraben war, wahrscheinlich kurz nach dem Einschiffen Ludwigs dem Heiligen ins Hl. Land im Jahre 1248 zu einer Art Parkplatz umfunktioniert worden, weshalb es jetzt passierte, dass nach dem Abflug meines Hutes, eine jener neuerdings marodierenden Rentnerinnen, fremdes Gut nicht achtend, mit wabbeligem Ärmchen und Spindelfingern aus einem giftgrünen Peugeot nach meinem herabgefallenen Hut griff und sich nicht entblödete, sich meines Besitzes zu bemächtigen. Auf der Wehrmauer stehend, sah ich in Panik meinem Hut hinterher, der so schnell flog, dass ich gar nicht mehr dazu kam, den Flug meiner Habe von der Mauer herab im Detail zu verfolgen. So blieb mir nichts anderes übrig, als hilflos seine Landung tief im Burggraben durch das naheliegende Loch eines mittelalterlichen Abtritts zu verfolgen. So wie der mittelalterliche Ritter wahrscheinlich einen letztes Blick auf seine schwindenden Exkremente warf, so erblickte auch ich durch den steinernen Abtritt den freien Fall meines guten Stücks.
Bogen tief unter mir in den Burggraben. Dieser Burggraben war, wahrscheinlich kurz nach dem Einschiffen Ludwigs dem Heiligen ins Hl. Land im Jahre 1248 zu einer Art Parkplatz umfunktioniert worden, weshalb es jetzt passierte, dass nach dem Abflug meines Hutes, eine jener neuerdings marodierenden Rentnerinnen, fremdes Gut nicht achtend, mit wabbeligem Ärmchen und Spindelfingern aus einem giftgrünen Peugeot nach meinem herabgefallenen Hut griff und sich nicht entblödete, sich meines Besitzes zu bemächtigen. Auf der Wehrmauer stehend, sah ich in Panik meinem Hut hinterher, der so schnell flog, dass ich gar nicht mehr dazu kam, den Flug meiner Habe von der Mauer herab im Detail zu verfolgen. So blieb mir nichts anderes übrig, als hilflos seine Landung tief im Burggraben durch das naheliegende Loch eines mittelalterlichen Abtritts zu verfolgen. So wie der mittelalterliche Ritter wahrscheinlich einen letztes Blick auf seine schwindenden Exkremente warf, so erblickte auch ich durch den steinernen Abtritt den freien Fall meines guten Stücks.
Angesichts des möglichen Verlusts muss mein Rufen dementsprechend verzweifelt geklungen haben…
Mehr demnächst. In Teil 2