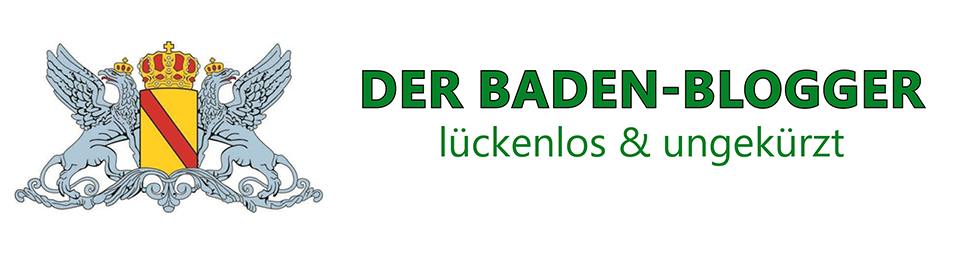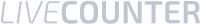Normalerweise beschäftigen wir uns hier vorwiegend mit den wichtigen Dingen des Lebens wie etwa diesen, dass wir kürzlich mit unserem Blog die Millionengrenze gerissen haben. Ein andermal gehen wir der Frage nach, warum Katzen auf Bäume klettern und zu guter Letzt von der Feuerwehr geborgen werden müssen. Weiter hatten wir jüngst das Thema, dass ein Jagdhund durch ein fallendes Herbstblatt so irritiert war, dass er einfach stehen blieb, dem sanften Fall des Blattes aufmerksam zusah und deshalb bei der finalen Eignungsprüfung durchfiel.
unserem Blog die Millionengrenze gerissen haben. Ein andermal gehen wir der Frage nach, warum Katzen auf Bäume klettern und zu guter Letzt von der Feuerwehr geborgen werden müssen. Weiter hatten wir jüngst das Thema, dass ein Jagdhund durch ein fallendes Herbstblatt so irritiert war, dass er einfach stehen blieb, dem sanften Fall des Blattes aufmerksam zusah und deshalb bei der finalen Eignungsprüfung durchfiel.
Das nur einige wenige Beispiele, die uns aber so wichtig erscheinen, dass wir glaubten, uns mit ihnen hier näher beschäftigen zu müssen. Neulich aber flog uns ein Thema förmlich zu, das eher abstrakt ist. Es dreht sich um die Frage: warum hat eigentlich heutzutage niemand mehr Schuld an irgendetwas?
Zunächst hier mal ein aktuelles, wenn auch fast politisch – philosophisches Beispiel: warum kann nach der aktuellen Lage offensichtlich niemand etwas dafür, wenn uns u.U. in nicht zu ferner Zukunft irgendwelche freundlich Zugezogenen sagen, wie wir zu leben haben.
Machen wir’s mal ne Nummer kleiner und bringen noch zwei andere Fälle. Wer ist z.B. letztlich Schuld, wenn der eigene Rechner immer mal wieder aus heiterem Himmel abstützt und unsere Daten im Nirgendwo verschwinden? Wo könnte man sich beschweren? Beim Vorstand eines Internetgiganten? Und wie verhält es sich mit den Finanzämtern? Alljährlich fragt man sich, warum unsere Steuerrückzahlungen erst nach gefühlt jahrelanger Verspätung auf unserem Konto eingehen, obwohl doch jede Verzögerung unserseits pünktlich mit massiven Strafzinsen geahndet werden. Fragt man am Amt nach, können die Leute dort dafür nun aber wirklich nichts. Ansonsten ist der Kollege dort eben mit Corona beschäftigt, lebt im Mutterschutz oder musste mal raus.
Das alles mag ziemlich ärgerlich ein; verglichen mit der Bahn ist das aber gar nichts!
Die Tatsache ist doch die: trotz offensichtlich größten Bemühungen seitens des Bahnbetriebs nimmt die Zahl der verspäteten oder ausgefallen Züge ständig zu. Da liegt die Frage nahe, wer eigentlich die Verantwortung für diese Unannehmlichkeiten oder Verspätungen letztlich trägt? Wer entschädigt den Reisenden für geplatzte Geschäftstermine, verpasste Flugverbindungen oder gar ausgefallene Begrüßungsküsse?
Erfahrungsgemäß wird ein Nachfragen wenig bringen. Nach Gründen für den Ausfall des Zuges gefragt erhält man ausweichende, wenn auch regional fein abgestimmt Antworten. In Berlin etwa wird die Antwort etwa so lauten: „Wees ik doch nich. Bin ik die Lok“? Oder weiter südlich: „Kann ich ihnen nich‘ sagen. Is‘ immer so“.
So bleibt nur zu konstatieren: nach Lage der Dinge kann neuerdings niemand mehr für irgendetwas. Keiner ist mehr Schuld. Es droht eine Zukunft der allgemeinen Nichtzuständigkeit.
Angesichts dieses Zustandes dürfen wir uns dann auch nicht wundern, wenn als schlüssiger Ausdruck all dieser Unzuständigkeiten neuerdings das Schulterzucken zur alles bestimmenden Geste der Schuld- oder Verantwortungslosigkeit zu werden droht. Ja, wie manch einer sich regelmäßig der körperlichen Ertüchtigung hingibt, so steht zu vermuten, dass ganze Heerscharen von Nichtverantwortungtragenden sich den lieben langen Tag in einem kollektiven Schulterzucken üben. Derart verbreitet, scheint das Heben und Senken der Schulter mittlerweile zu einem regelrechten Massenphänomen geworden zu sein.
So bleibt uns Geschädigten nur noch zu hoffen, dass sich die täglich vermehrende Masse der Nichtverantwortlichen beim alltäglichen Schulterzucken wenigstens die Schulter verrenkt. Was zugegebenermaßen ein eher schwacher Trost ist.
Aber dafür können wir ja nun wirklich nichts.
Springende Pferde im Baselbiet Teil 1
Gross. Schön. Stark. Ferrari Garage in Basel neu eröffnet.
Der Herr im Trachtenjanker ist ziemlich ungeduldig. Wann denn jetzt endlich sein Espresso käme? Im Übrigen könne er keine vier Jahre auf einen Ferrari warten. Nachdem er dies hat verlauten lassen, steigt er mit beachtlichem Altherrenfuror in seinen vor dem Showroom abgestellten älteren Aston Martin, klappt das Verdeck nach hinten und braust davon. Von Basel Stadt nach Basel Land.
Angesichts seines fortgeschrittenen Alters mag das zwar verständlich sein, andererseits ist es aber auch schade, denn durch diesen Schnellstart entgeht dem Rastlosen der Genuss einer einzigartigen Ferrari-Präsentation, die am letzten Aprilwochenende im neuerrichteten Ferrarizentrum Niki Hasler geboten wurde.
5000qm sind es nach den Plänen des Architektenduos Diener & Diener geworden. Sie verteilen sich auf 6 Ebenen. Damit will man den je verschiedensten Bedürfnissen der Kundschaft Rechnung tragen. Betritt man den Eingangsbereich des Gebäudes erwartet einen zunächst die gesamte breite Palette der aktuellen Modelle, die Wagen der Baureihe 488, Superfast und GTC Lusso.
 An historischen Fahrzeugen herauszuheben wären da z.B. der bildschöne Ferrari 250 GTO, dessen ‚Bruder‘ jüngst in einer Versteigerung
An historischen Fahrzeugen herauszuheben wären da z.B. der bildschöne Ferrari 250 GTO, dessen ‚Bruder‘ jüngst in einer Versteigerung umgerechnet 28 Millionen Euro erzielte. Dann der Ferrari LUSSO, hier noch aufgebockt, was einen für den Technikinteressierten seltene Einblicke in die Mechanik ermöglicht. Dann auch einen reinen historischen Rennwagen – den Ferrari 512, eine Baureihe, die seinerzeit von Jackie Ickx mit großem Erfolg bewegt wurde.
umgerechnet 28 Millionen Euro erzielte. Dann der Ferrari LUSSO, hier noch aufgebockt, was einen für den Technikinteressierten seltene Einblicke in die Mechanik ermöglicht. Dann auch einen reinen historischen Rennwagen – den Ferrari 512, eine Baureihe, die seinerzeit von Jackie Ickx mit großem Erfolg bewegt wurde.
Von so viel Schönheit geblendet, begibt man sich zunächst einmal in Richtung der beiden Werkstätten, wo fein unterschieden wird zwischen Restaurierung der älteren und Pflege der neuen Modelle.
Niki Hasler, der Eigner der Niederlassung, hatte zunächst seine Gäste am Empfang begrüßt. Sein zurückhaltend freundliches Auftreten findet seine Entsprechung im Benimm seiner möglichen Kundschaft, die, da wird man nicht falsch liegen, in den besseren Kreisen der deutschsprachigen Schweizer Bürger zu finden ist. Wie vielerorts, so spricht man auch in Basel ungern übers Geld, und schon gar nicht wenn man es hat. Man kennt sich. So kann man tatsächlich Zeuge werden, wie alteingesessene Ferrari Fans erfreut Erfreuliches zu berichten wissen, wie man z.B. vor vielen Jahren, also noch lange vor dem Boom, doch erstaunlich günstig einen seltenen alten Ferrari erstanden hatte.

Jetzt ist es erst mal an der Zeit, sich über die ganze Breite des Angebots zu informieren. Da wäre z.B. der Service, seinen Ferrari dauerhaft in der hauseigenen Garage unterzustellen. Der Besitzer erhält per Chip jederzeit Zugang zu seinem Wagen. Mit dem Aufzug nach unten bewegt, kann er nun seine Fahrten ins Basler Umland starten. Anschließend stellt er seinen Ferrari wieder in der Niederlassung ab, wo er dann für weitere Ausfahrten betankt, gereinigt usw. wird. Woraus man auch schließen könnte: der Basler hat es gern ebenso komplett wie diskret.
Da wird es nicht verwundern, dass beim Betrachten des festlich gestimmten Premierenpublikums weder die nachtaffinen Beschützer auffallend schöner Frauen zu entdecken sind, noch fallen einem fussballspielende Persönlichkeiten mit Goldkettchen und Bleibeperspektive ins Auge. Beide an sich solvente Gruppen tendieren bei der Wahl ihres Fahrzeugs ohnehin eher zu den Marken Lamborghini oder AMG Mercedes, was den Herren dieses Hauses nicht verdrießen muss, zumal mit Promi- Rabatten ohnehin nicht zu rechnen ist.
Im Keller hingegen befinden sich die Katakomben des Luxus – hier warten die historischen Modelle auf ihre neuen Besitzer. Und dann wäre da noch die Abteilung ‚Individualisierung‘, die mit den angebotenen 30 verschiedenen Lackierungen farbenfroh belegt, dass die Farbe Rot mitnichten das Ende aller Wünsche bedeuten muss.
Springende Pferde im Baselbiet Teil 2
Gross. Schön. Stark. Ferrari Garage in Basel neu eröffnet.
Doch sollte man sich keinen Illusionen hingeben. Selbst wenn der Mythos, wie bei dieser Eröffnung zu sehen, augenfällig gepflegt wird, so lässt sich doch nicht leugnen, dass auch Ferrari, 30 Jahre nach dem Tod des Commendatore, dabei ist, sich zu einem ganz normalen, aktienbasierten Autohersteller zu wandeln.
sich doch nicht leugnen, dass auch Ferrari, 30 Jahre nach dem Tod des Commendatore, dabei ist, sich zu einem ganz normalen, aktienbasierten Autohersteller zu wandeln.
Und vielleicht sind zwei Punkte die signifikantesten Zeichen. Zum einen das Ausscheiden der jahrzehntelang prägenden Designfirma Pinifarina, von der man sich erst in den letzten Jahren verabschiedet hatte und deren atemberaubende Karosserien noch bis heute das Image prägen: Ihre Formen haben sich tief ins Bewusstsein und ins Auge der Ferraristi eingeprägt.
 Und dann – fast noch gravierender – die für die traditionsbewussten Freunde des Hauses überaus schroffe Trennung vom langjährigen Ferrari-Lenker Luca di Montezemolo. Er war noch von Enzo Ferrari eingestellt und hatte als Rennleiter den Rennstall Ferrari zu unzähligen Weltmeisterschaften geführt. Zudem hatte er über einen langen Zeitraum die Weichen für das finanzielle Wohlergehen der Firma gestellt.
Und dann – fast noch gravierender – die für die traditionsbewussten Freunde des Hauses überaus schroffe Trennung vom langjährigen Ferrari-Lenker Luca di Montezemolo. Er war noch von Enzo Ferrari eingestellt und hatte als Rennleiter den Rennstall Ferrari zu unzähligen Weltmeisterschaften geführt. Zudem hatte er über einen langen Zeitraum die Weichen für das finanzielle Wohlergehen der Firma gestellt.
Er war es, der den Mythos ‚Ferrari‘ maßgeblich geprägt hatte, bis er dann schleßlich vom stets pullovertragenden obersten Fiat/Ferrari – Lenker Sergio Marcionne entlassen wurde. Dem war offensichtlich ein galoppierender Aktienkurs wichtiger war als das springende Pferd.
 So ist es vielleicht gerade der in einer sogenannten ‚Roadshow‘ präsentierte Ferrari ‚Portofino‘, der mit seinem aktuellen, von Pininfarina nicht mehr verantworteten Design, für die neue Zeit steht. Ein Supersportwagen, dessen Verdeck auf Knopfdruck verschwindet und ausgestattet mit Automatikgetriebe, keineswegs mehr nach strammen Männerwaden verlangt.
So ist es vielleicht gerade der in einer sogenannten ‚Roadshow‘ präsentierte Ferrari ‚Portofino‘, der mit seinem aktuellen, von Pininfarina nicht mehr verantworteten Design, für die neue Zeit steht. Ein Supersportwagen, dessen Verdeck auf Knopfdruck verschwindet und ausgestattet mit Automatikgetriebe, keineswegs mehr nach strammen Männerwaden verlangt.
Schöne neue Welt. Jetzt wohl in der Planung sogar ein Ferrari SUV. Den hatte Luca de Montezemolo („Ich bin der Ansicht, Ferrari sollte keine SUV bauen“) noch strikt abgelehnt. Mächtig, groß und stark soll er werden. Fürs Mutti-Rennen in der Basler Innenstadt genau so geeignet wie fürs Flanieren auf der Züricher Bahnhofstrasse.
Niki Hasler wird’s freuen.
PHOTOGALERIE – weil’s so schön war, hier noch ein paar Fotos
„Tintenfisch“ Folge 1
 „Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen“.
„Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen“.
Uns an den Worten des großen Frankfurters J. W. Goethe orientierend, wollen wir unser Angebot hier ein bisschen ergänzen.
Immer mal wieder flattern uns nämlich Beiträge, Geschriebenes, Gereimtes auf den Schreibtisch, das wir – neben all dem vielen anderen – als veröffentlichungswürdig ansehen. Die Texte sollten sich zumindest im Entferntesten mit Baden-Württemberg befassen, und wenn sie das einmal nicht tut, dann – nun ja – ist es auch recht. Nur allzu lang sollten die Texte nicht sein, denn zu vom zu Langen gibt’s schon zu vieles. Wir nennen diese Reihe jetzt der Zweckmäßigkeit halber ‚Tintenfisch‘, denn wie ein Fischlein sollen sich diese kurzen Texte im langen, breiten Strom des sonst Veröffentlichten bewegen. Da wir das jetzt wirklich gut formuliert haben, wollen wir uns nicht länger mit uns selbst befassen, sondern gleich den ersten ‚Tintenfisch‘ betrachten (nicht grillen!).
Katzenmusik
Meine erste Studentenbude war 11 qm groß. Sie kostete 80 Mark und war auf einem Bauernhof in der Gemeinde St. Georgen bei Freiburg.
Die Zimmerwirtin hieß mit dem Vornamen ‚Marie’, wurde aber von den dort wohnenden Studenten respektvoll Frau Keller genannt. Kamen Einheimische, begrüßten sie die Bäuerin mit ‚Bieri’, was diese voller Stolz die große Brust heben ließ.
Wenn ich mein kleines Zimmer verließ, begegnete ich regelmäßig einer früh gealterten Frau. Es war die Magd. Alle nannten sie nur ‚d’Louis’. Sie bewohnte die Kammer mir gegenüber, die – es war mir nie vergönnt, einen Blick hinein zu werfen – bestimmt nicht größer war als meine. Das war aber das einzige, das wir gemeinsam hatten. Ansonsten trennte uns nicht nur ein kleiner Gang, sondern auch noch ein unterschiedlicher Musikgeschmack. In den wenigen Tagesmomenten, da sie sich in ihren 11 qm aufhielt, hörte ich durch die geschlossene Türe nur einmal Musik: es waren die Klänge einer Blaskapelle am Sonntagmorgen. Die Magd musste also ein Radio gehabt haben. Ich hörte damals vor allem die ‚Rolling Stones’, was ihr offensichtlich nicht verborgen geblieben war.
 Als ich eines abends hinter meinen Leitz Ordnern ein Rascheln hörte, zog ich zwei Ordner hervor und blickte in die kleinen Augen einer Maus, die mich ebenso erschrocken ansah wie ich sie. Am nächsten Morgen bat ich meine Zimmerwirtin um eine Mausefalle und Speck. Sie gab zunächst zu bedenken, dass man mit so einer Falle vorsichtig umgehen müsse; damit könne man viel Unheil anrichten. Vor allem wisse man ja nie, was für ein Mäuschen sich darin verirrte. Dann aber hörte ich am Ende des Ganges die krächzenden Stimme der Magd: „Bi dere Müsik gibt’s kei Miees“, was auf gut Deutsch heißt: dass es bei der von mir gehörten Musik keine Mäuse gäbe.
Als ich eines abends hinter meinen Leitz Ordnern ein Rascheln hörte, zog ich zwei Ordner hervor und blickte in die kleinen Augen einer Maus, die mich ebenso erschrocken ansah wie ich sie. Am nächsten Morgen bat ich meine Zimmerwirtin um eine Mausefalle und Speck. Sie gab zunächst zu bedenken, dass man mit so einer Falle vorsichtig umgehen müsse; damit könne man viel Unheil anrichten. Vor allem wisse man ja nie, was für ein Mäuschen sich darin verirrte. Dann aber hörte ich am Ende des Ganges die krächzenden Stimme der Magd: „Bi dere Müsik gibt’s kei Miees“, was auf gut Deutsch heißt: dass es bei der von mir gehörten Musik keine Mäuse gäbe.
Damit war das Thema erledigt. Das Tierchen ist danach nie mehr aufgetaucht.
Ode an den Wurstsalat
Gerade in diesen so überaus harten Zeiten, sollten wir uns hier kurz und wehmütig an die Leib- und Magenspeise erinnern, die uns stets, in guten wie in schlechten Zeiten unseren Bierdurst erst so richtig abrundet. Es ist der Wurstsalat.
die Leib- und Magenspeise erinnern, die uns stets, in guten wie in schlechten Zeiten unseren Bierdurst erst so richtig abrundet. Es ist der Wurstsalat.
Natürlich braucht es dazu keine Wirtschaft. Wir können den Wurstsalat auch daheim essen. Schließlich gibt’s Ringe aus Fleischwurst überall. Auch wird es in der heimischen Küche an Öl, Zwiebeln und auch an Essig nicht fehlen. Aber gerade im Verzicht auf den Wurstsalat daheim liegt ein Stück weit das große Glück dieses besonderen Genusses. Dem sollte man sich am besten im Freien hingeben.
Wenn wir ihn da essen wollen, wo er hingehört, fällt uns voller Sehnsucht natürlich gleich mal der Biergarten ein. Die Sonne scheint, der Kies knirscht. Ab und zu lässt der Baum, in dessen Schatten wir trinken, ein Blatt leise zu Boden fallen. Wir haben unsere Zeitung dabei. Das Oldtimer Cabrio steht mit offenem Verdeck vor der Wirtschaft. Dort, wo von Zeit zu Zeit unser Blick hin wandert. Die Bedienung, die uns kennt, ruft schon von Ferne: wie immer? Aber sicher! Und dann kommt’s. Erst kommt das Bier, und dann haben wir auch noch den Salat. Den Wurstsalat. Sieht fast nach einem Wunder aus, wie er da so vor uns steht.
Doch auch ein Wunder will angerichtet sein. Denn was sich so einfach anhört, ist so einfach nicht. Ein Wurstsalat ist – auch wenn man es ihm nicht ansieht – ein komplexes Gebilde. Es gibt ihn zunächst ganz einfach als Wurstsalat. Dann aber geht’s schon los. Es gibt ihn in der Variante ‚Straßburger‘ Wurstsalat, also mit Schweizer Käse. Oder aber auch als ‚Elsässer‘ Wurstsalat, was aber das Gleiche ist. Manche Bedienungen fragen nach. Sagt man ‚Straßburger’, sagen sie ‚Elsässer‘? Sagt man ‚Elsässer‘ fragen sie ‚Straßburger‘? Scheint, als wartet auf den Genießer eine ganze Palette von geschmacklichen Möglichkeiten.
Im Schwäbische gibt’s z.B. noch den ‚Schwäbischen Wurstsalat“ (richtig erraten!), der sich vom Badischen (oder Elsässer) darin unterscheidet, dass er mit Schwarzwurst zubereitet wird.
Die Fleischwurst sollte dünn geschnitten sein, nicht zu viel Öl und schon gar nicht zu viel Essig. Grundsätzlich sollte er gut durchgezogen sein, aber anderseits auch wieder nicht zu lange. Nicht, dass da was Lätschiges vor uns im Teller liegt. Manche raspeln den Käse flockenartig über die Wurst. Auch gut. Vor allem hat man das nicht alle Tage. So gesehen ist ein Wurstsalat ein bisschen wie ein Überraschungsei. Man weiß nie, was man kriegt.
Das kann einem in Bayern nicht passieren. Der Wurstsalat, den sie uns da auftragen, ist in der Regel ein merkwürdiges Ding – man kann es nicht anders sagen. Da schwimmen doch tatsächlich Fleischwursträdchen in einer Mischung aus Wasser und Essig, soviel Flüssigkeit, dass die Wurst da drin kaum Luftholen kann. Hat man viel Glück, hat das Personal die Hälfte der Soße beim Anmarsch schon verschüttet. Sonst besorgen sie es beim Abstellen des Tellers. Den verbleibenden Rest kann man mit der meist extra in Rechnung gestellten ‚Semmel‘ kaum auftunken. Was bleibt, ist oft genug eine vollgekleckerte Hose, immer noch Hunger und ein Zwiebelgeschmack im Mund, der uns beim nächstes Mal einen (meist exzellenten!) Schweinebraten bestellen lässt.
Ansonsten hätte auch hier gegolten: weniger Zwiebeln sind mehr. Wie zu viel Knoblauch ein Essen komplett verhunzen kann, so kann einem das auch mit dem ‚Überzwiebeln‘ passieren. Klein-geschnitten sollten sie sein, die Zwiebelchen. Eine zarte Beimischung. Sind es zu viele, drängen sie sich geschmacklich in den Vordergrund, wo sie nicht hingehören. Wenn’s halt trotzdem mal passiert, muss ein Schnaps her.
Ist man soweit gekommen, braucht es jetzt eigentlich nur noch meine Lieblingsbeigabe. Aufgeblasene Schreiberlinge würden das eine ‚kongeniale Ergänzung‘ nennen. Wir aber nennen es Bratkartoffeln. Manche sagen Brägele, was in Ordnung geht. Hauptsache, man weiß, was gemeint ist. Das Dümmste allerdings ist, wenn man uns sogenannte ‚Bratkartöffele‘ andrehen will. Da krieg ich die Krise.
Ansonsten habe ich die Bratkartoffeln gern fein geschnitten. Können auch ein bisschen fett sein. So zünden sie die nächste Stufe in der Geschmacksrakete. Natürlich tut’s Brot auch, erfahrungsgemäß sparen Wirte aber oft am Brot. Sehe ich manchmal die zwei Scheiben auf dem Teller, kommt es mir vor, als würde ich die schon vom ALDI kennen. Dem entgeht man, wenn man gleich der Bratkartoffel sein Ja-Wort gibt. Brot kann dann weg. Ich persönlich finde, dass erst durch die Beilage – die alte DDR hätte es eine ‚Sättigungsbeilage‘ genannt – so ein Wurstsalat zu einem richtigen Essen wird.
Das Hors d’oeuvre kann dann entfallen. Das Dessert nehmen wir morgen. Selbst wenn die Wetterlage stabil scheint, tut man im Biergarten gut daran, sich auf’s Wesentliche zu konzentrieren. Auf einen Wurstsalat.